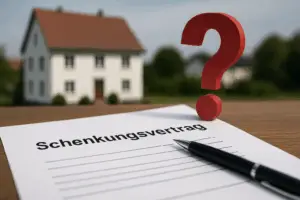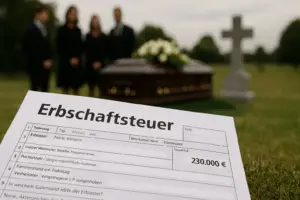Mehr als jede dritte Erbschaft in Deutschland führt zu einem Streit. Studien gehen davon aus, dass mindestens 30–40 % aller Nachlässe mit juristischen Auseinandersetzungen oder tiefen familiären Zerwürfnissen enden. Dabei sagen viele: „Unsere Kinder streiten sich doch nicht.“ Oder: „Bei uns ist ja nichts zu holen.“
Doch diese Annahmen trügen. Konflikte entstehen nicht erst ab einer Million – sondern ab einer ungeregelten Erwartung. Es sind nicht nur Häuser oder Aktien, die Menschen entzweien, sondern Kerzenhalter, Schmuckstücke, alte Fotos oder Pflichtteilsansprüche allgemein. Denn jeder Gegenstand erzählt auch eine Geschichte – und damit verbunden eine Erinnerung, eine Emotion, ein Gefühl von Zugehörigkeit.
Der folgende Artikel beleuchtet, warum es selbst in den besten Familien zum Streit kommen kann – und wie sich das verhindern lässt. Er zeigt konkrete, erprobte Wege auf, wie Vermögen so weitergegeben werden kann, dass Verbindungen gestärkt statt zerstört werden.
📌 Hinweis: Diese Information dient der allgemeinen Orientierung und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Für konkrete Fragen empfiehlt sich die Konsultation eines Notar:in, Fachanwalts oder Fachanwältin bzw. Spezialist:innen der steuerberatenden Berufe.
Warum kommt es überhaupt zu Streit beim Erben und Schenken?
Die Hoffnung vieler Familien lautet: „Unsere Kinder werden sich nicht streiten.“ Oder: „Bei uns gibt es ja nichts zu holen – was soll da schon passieren?“ Doch genau hier liegt ein gefährlicher Trugschluss. Denn Streit entsteht selten nur wegen des Geldes. Oft sind es die unausgesprochenen Erwartungen, alten Wunden oder kleinen Symbole des Zusammenlebens, die zur Eskalation führen. Und das gilt auch für Schenkungen zu Lebzeiten. Je komplexer die Familienbande ist, desto wahrscheinlicher ist ein Streit. Mit einer vorausschauenden Gestaltung der gesetzlichen Erbfolge, wie z.B. durch ein Testament, kann man viele verborgene Begehrlichkeiten offenlegen und versuchen die zu verarbeiten.
Unterschiedliche innere Wirklichkeiten – Rationalität trifft Emotion
Ein klassisches Szenario: Die Eltern versterben. Ein Kind sagt: „Wir müssen das Haus verkaufen. Wer soll es pflegen, die Kosten tragen? Und wir brauchen das Geld.“ Ein anderes sagt: „Das geht nicht. Hier haben wir Weihnachten gefeiert. Mama hätte das niemals gewollt.“
Beide Sichtweisen sind verständlich – und dennoch unvereinbar, wenn es an Empathie und Kommunikation fehlt.
Hinter diesen Reaktionen stehen tief verwurzelte Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur:
- Pragmatisch denkende Familienmitglieder wollen Probleme lösen, organisieren, rechnen.
- Emotional geprägte Familienmitglieder denken in Erinnerungen, Beziehungen, Symbolen.
Ein Apfelbaum im Garten, die alte Vase auf dem Kaminsims, die handgeschriebenen Briefe in der Schublade – für den einen bedeutungslos, für den anderen unbezahlbar.
Wenn hier nicht miteinander gesprochen wird, entsteht rasch das Gefühl von Kälte auf der einen und Sentimentalität auf der anderen Seite. Und so wird aus einem sachlichen Thema ein familiärer Ausnahmezustand.
Unterschiedliche Lebensrealitäten: Nähe, Pflege und Verantwortung
Auch die Lebenssituation innerhalb der Familie kann zu Spannungen führen:
- Ein Kind lebt weit weg, war jahrelang kaum präsent.
- Ein anderes wohnt in der Nähe, hat im Alltag geholfen, vielleicht sogar gepflegt oder verzichtet.
- Das dritte hatte selbst schwere Jahre – und war innerlich weit weg, obwohl räumlich nah.
Wenn der Nachlass verteilt wird, kommt all das auf den Tisch. Und plötzlich wird gerechnet – nicht nur in Euro und dem zustehenden Pflichtteil, sondern in gefühlter Nähe, in geleisteter Fürsorge, in still ertragenem Verzicht. Wer dann gleich behandelt wird, fühlt sich vielleicht ungerecht behandelt. Wer mehr bekommt, wird zum Ziel von Neid. Wer weniger bekommt, fühlt sich zurückgesetzt.
Alte Geschichten brechen auf
Ein weiteres Phänomen: Die Vergangenheit wird neu verhandelt.
Erinnerungen sind selten objektiv – und oft ungleich verteilt.
- „Ich war immer Papas Lieblingskind.“
- „Du hast doch schon immer mehr bekommen – denk an dein Studium in der Schweiz!“
- „Du warst nie da, als es Mama schlecht ging.“
Solche Sätze kommen nicht aus dem Nichts. Sie haben sich über Jahre aufgebaut – wurden aber nie ausgesprochen. Die Verteilung des Nachlasses oder einer Schenkung wirkt dann wie ein Auslöser. Was früher unter der Oberfläche brodelte, tritt nun offen zutage. Und der eigentliche Streit wird zum Stellvertreterkonflikt für Jahrzehnte familiärer Ungleichgewichte.
Die Illusion der Gleichheit
Viele Eltern möchten alles „gerecht“ regeln – und verstehen darunter: „Alle bekommen das Gleiche.“ Doch Gleichheit ist nicht immer Fairness.
- Wer jahrelang gepflegt hat, empfindet es als unfair, dass alle das Gleiche bekommen.
- Wer früher schon finanzielle Unterstützung erhalten hat, schweigt oft – in der Hoffnung, es werde nicht aufgerechnet.
- Wer leer ausgeht, fühlt sich ausgeklammert – auch wenn es gute Gründe gab.
Ohne klare Kommunikation entsteht schnell das Gefühl: „Ich werde nicht gesehen.“ Und wo Menschen sich nicht gesehen fühlen, beginnt das Misstrauen – oft tief, persönlich und dauerhaft.
Dritte im Spiel: Schwiegerkinder, neue Partner & Co.
Ein weiteres Konfliktfeld liegt in der Einmischung durch Dritte. Schwiegerkinder oder neue Lebenspartner sehen die Familie mit anderen Augen – oft sachlicher, aber manchmal auch mit eigenen Interessen. Sie haben keine gemeinsame Kindheit, keine Erinnerungen an Familienrituale – und urteilen nach anderen Maßstäben. Man muss sich klar machen, dass die eigenen Kinder meist mehr Zeit mit ihren Partnern und Kindern verbracht haben, als mit ihren Geschwistern. Zudem diese glücklichen Zeiten schon lange zurückliegen und oft nur vage Erinnerungen sind.
Typisch vom eigenen Partner ist oft ein Satz wie: „Dein Bruder hat doch schon genug – jetzt musst du auch mal an deine Kinder denken.“
Solche Sätze können das Familiengefüge verschieben – und aus Verbündeten Gegner machen.
Fazit: Wer schenkt oder vererbt, trägt die Verantwortung – nicht die Erben
Streit entsteht nicht nur durch Gier oder Missgunst – sondern durch unausgesprochene Erwartungen, emotionale Verletzungen und das Fehlen klarer Strukturen. Und auch wenn es tröstlich wäre zu glauben, „die Kinder regeln das schon“, zeigt die Realität: NEIN! Genau das passiert oft nicht.
Die erste Verantwortung, dass das Vermögen nicht zur Zerreißprobe wird, liegt nicht bei den Kindern. Und auch nicht bei den Enkeln oder anderen.
Sie liegt bei dem Menschen, der heute entscheidet, was morgen bleibt.
Nur wer schenkt, vererbt oder gestaltet, hat die Möglichkeit, Klarheit zu schaffen – und die Wahrscheinlichkeit von einer völlig zerstrittenen Familie deutlich zu verringern.
Das heißt nicht, dass alles perfekt geregelt sein muss. Aber es heißt: bewusst handeln statt dem Zufall überlassen.
Wer Konflikte vermeiden möchte, sollte bereit sein, sich ihnen im Vorfeld zu stellen – nicht am Ende, wenn es zu spät ist.
1. Das Gespräch suchen – aber richtig
Es klingt einfach. Doch reden über das Erbe oder eine Schenkung ist für viele Menschen alles andere als leicht. Zu groß ist die Angst, alte Wunden aufzureißen. Zu groß die Unsicherheit, wie das Gegenüber reagieren könnte.
Was wie ein harmloser Kaffeetisch beginnt, kann in Schweigen enden. Nicht, weil niemand reden möchte – sondern weil niemand weiß, wie man über so etwas spricht, ohne gleich Schuld, Misstrauen oder Vorwürfe im Raum stehen zu lassen.
Dabei zeigt sich in der Praxis: Die meisten Konflikte entstehen nicht, weil etwas falsch geregelt wurde – sondern weil gar nicht darüber gesprochen wurde.
Warum Reden trotzdem der wichtigste Schritt ist
In vielen Familien herrscht das unausgesprochene Gesetz, dass man über Geld nicht spricht. Schon gar nicht über das Erbe. Noch weniger über gerechte Verteilung. Und am allerwenigsten über Erwartungen.
Doch genau hier liegt der Nährboden für Streit – denn was im Verborgenen bleibt, wird im Ernstfall interpretiert.
- „Ich dachte, ich sollte das Haus bekommen.“
- „Du wusstest doch, dass Mama mir das Armband versprochen hat.“
- „Das mit dem Konto hat Papa nie so gemeint.“
Solche Sätze sind oft nicht böse gemeint – sondern Ausdruck tiefer Unsicherheit.
Wie gute Gespräche vorbereitet werden können
Ein klärendes Gespräch braucht Zeit, Raum und Struktur.
Zwischendurch auf dem Weg zum Supermarkt oder am Geburtstagstisch – das reicht nicht. Wer möchte, dass sein Wille verstanden wird, sollte dem Thema auch die entsprechende Bedeutung geben.
Ein bewährter Weg: Ein Gespräch aktiv terminieren. Ganz bewusst einladen – nicht zum Kuchen, sondern zum Austausch.
Wer sich dabei unsicher fühlt, kann Hilfsmittel nutzen:
- Ein Gesprächsleitfaden (Stichpunkte genügen oft)
- Ein neutraler Dritter, der das Gespräch moderiert
- Oder – ganz pragmatisch – Unterstützung durch KI: etwa beim Formulieren der eigenen Gedanken, beim Entwickeln möglicher Fragen oder beim Strukturieren der Themen.
Reflexion ist der Schlüssel. Wer sich vorab Gedanken macht, wirkt im Gespräch klarer – und ist gleichzeitig besser in der Lage, auf Einwände empathisch zu reagieren.
2. Wer bekommt was – und warum? Entscheidungen nachvollziehbar machen
Viele denken beim Stichwort „Erbe“ an Gegenstände: das Elternhaus, das Familiensilber, vielleicht eine alte Taschenuhr.
Doch rechtlich betrachtet ist Erben viel mehr: Der oder die Erben treten in sämtliche Rechte und Pflichten ein. Sie werden sogenannte Gesamtrechtsnachfolger. Das bedeutet: Sie übernehmen das ganze Vermögen – aber auch Schulden, Verpflichtungen, Verträge.
Wer hingegen nur bestimmte Dinge zuweist – „Das Haus soll X bekommen“ oder „Das Konto geht an Y“ –, bewegt sich schnell im Bereich des Vermächtnisses.
Und hier entstehen oft Missverständnisse. Denn ein Vermächtnis bedeutet nicht automatisch Eigentum, sondern erst einmal nur einen Anspruch gegenüber den Erben. Wird das nicht korrekt geregelt, sind Konflikte vorprogrammiert.
Lieber gemeinsam besprechen, statt festlegen: Was wird überhaupt vererbt?
Gerade Eltern, die ihr Vermögen verteilen möchten, stehen oft vor der Frage:
Wie sagt man’s den Kindern? Und wie viel sollte man überhaupt schon planen?
Die Antwort lautet oft: Weniger aufteilen – mehr erklären.
Statt einen Zettel zu schreiben, wer welche Möbel oder welches Konto bekommt, kann es hilfreicher sein, sich mit der Familie zusammenzusetzen – und zu sagen:
- Was ist überhaupt vorhanden? (Immobilien, Barvermögen, Beteiligungen)
- Welche Gedanken gibt es zur künftigen Aufteilung?
- Gibt es emotionale Bindungen an bestimmte Dinge?
- Was ist noch offen – etwa Kredite, Pflegeabsicherung, Rücklagen?
Das Ziel: ein gemeinsames Verständnis schaffen.
Nicht alles muss final geregelt sein – aber ein klarer Rahmen hilft, spätere Konflikte zu vermeiden.
Keine juristische Konstruktion am Küchentisch
Wer seine Gedanken zu Papier bringt, meint es gut – doch ohne rechtliche Beratung kann schnell das Gegenteil eintreten:
Ein handgeschriebener Zettel mit Zuweisungen einzelner Gegenstände kann später zu Streit, Unklarheiten und sogar zur Ungültigkeit von Teilen des Testaments führen.
Besser: Die eigenen Wünsche offenlegen, mit den potenziellen Erben besprechen – und erst danach die konkrete Regelung gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau aufsetzen.
3. Gerecht heißt nicht immer gleich – und Gleichheit ist nicht immer gerecht
„Alle sollen das Gleiche bekommen.“
Ein Wunsch, der häufig geäußert wird – und doch oft an der Lebensrealität vorbeigeht. Denn Gleichheit ist nicht automatisch Gerechtigkeit.
In der Praxis sieht es so aus: Ein Kind lebt in der Nähe, hilft im Alltag, pflegt die Eltern. Ein anderes wohnt weiter weg, hat vielleicht andere familiäre Belastungen – oder wurde in jungen Jahren bereits umfangreich unterstützt.
Wer all das ignoriert und den Taschenrechner zückt, um alles „eins zu eins“ zu verteilen, schafft oft genau das, was vermieden werden soll: Streit.
Was sich nach außen fair anhört, kann sich im Inneren ungerecht anfühlen
Ein Beispiel:
Zwei Kinder erben je die Hälfte. So weit, so gut.
Doch eines der beiden hat sich jahrelang gekümmert – auf Urlaube verzichtet, finanzielle Einbußen in Kauf genommen, den Eltern beim Älterwerden zur Seite gestanden.
Die andere Person lebt am anderen Ende des Landes, kam zu Weihnachten vorbei und war in Gedanken stets wohlwollend – aber eben nicht präsent.
Was passiert?
Die gerechte Aufteilung auf dem Papier wird zur Quelle von Unfrieden im Herzen.
Umgekehrt: Wer einem Kind mehr zukommen lässt, weil es wirtschaftlich schwächer dasteht, kann ebenfalls Unmut säen – etwa wenn ein Geschwisterteil seit Jahren hart für seinen Erfolg arbeitet und plötzlich „zurückgesetzt“ erscheint.
Was also tun? Augenmaß, Respekt und ehrliche Worte
Der Schlüssel liegt nicht in mathematischer Gleichverteilung, sondern in der Verständlichkeit des „Warum“.
Wer begründet, warum ein Kind mehr bekommt – etwa wegen Pflege, Bedürftigkeit oder früheren Ausgleichsleistungen – nimmt anderen die Möglichkeit, in eine Neiddebatte zu verfallen.
Zugleich ist wichtig: Nicht jedes Kind muss gleich sein, aber jedes sollte sich gesehen fühlen.
Das kann bedeuten:
- Gemeinsames Gespräch über Wünsche & Erwartungen
- Dokumentation früherer Schenkungen (Transparenz!)
- Testamentsgestaltung mit begleitenden Worten, nicht nur Zahlen
Denn manchmal ist ein Satz wie „Ich habe dich nicht vergessen“ im Testament mehr wert als 10.000 Euro.
4. Schenkungen offen kommunizieren – Schweigen ist diesmal nicht Gold
In vielen Familien läuft es so: Ein Kind baut ein Haus, die Eltern helfen – sagen wir mit 30.000 Euro.
Das andere Kind lebt in einer Mietwohnung, hat keinen akuten Bedarf.
Gedacht ist: „Das bekommt dann auch etwas – später.“
Doch hier liegt das Problem:
Das eine Kind fühlt sich großzügig bedacht. Das andere – leer ausgegangen.
Nicht weil es unfair behandelt wurde. Sondern weil niemand erklärt hat, wie diese Entscheidung zustande kam.
Eltern denken in Situationen – Kinder in Beträgen
Für die Eltern ist klar:
„Kind A baut. Da helfen wir. Kind B ist noch nicht so weit – kommt später dran.“
Aber Kind B hört:
„Ich bekomme nichts. Warum?“
Vielleicht denkt es über Selbstständigkeit nach.
Oder braucht Rücklagen für ein späteres Projekt.
Oder empfindet einfach, dass es nicht gesehen wird – obwohl es vielleicht ganz andere Pläne hat, die nicht weniger wertvoll sind.
Das Ergebnis: Frust, Neid – und im schlimmsten Fall ein zerbrochenes Vertrauensverhältnis.
Wenn dann noch Inflation & Zeit ins Spiel kommen
Ein besonders heikler Punkt entsteht, wenn zeitlich versetzt geschenkt wird:
Das erste Kind bekommt heute 30.000 Euro. Das zweite – fünf Jahre später – ebenfalls 30.000 Euro.
Klingt fair? Ist es aber oft nicht.
Denn:
- Der Wert des Geldes hat sich verändert
- Die Immobilie des ersten Kindes hat an Wert gewonnen
- Und das zweite Kind fühlt sich benachteiligt, weil sein Vorhaben vielleicht anders (weniger „familiär relevant“) erscheint
Wer hier nicht erklärt, verliert.
Wie lassen sich Missverständnisse vermeiden?
Die Lösung liegt nicht im Rechnen – sondern im Reden.
- Offene Gespräche führen, bevor Geld fließt
- Transparent machen, was warum gegeben wird – und wie man mit zukünftigen Unterstützungen umgeht
- Am besten schriftlich festhalten, ob etwas als „vorweggenommene Erbfolge“ gedacht ist – oder nicht
Es hilft auch, zu betonen:
👉 „Wir möchten euch beide gleich behandeln – aber nicht unbedingt zum selben Zeitpunkt.“
Denn was Eltern im Herzen gerecht finden, muss in den Augen der Kinder nachvollziehbar sein.
5. Schwiegerkinder, neue Partner & Patchwork – wenn Familien sich neu sortieren
Kaum etwas verändert das familiäre Gleichgewicht so sehr wie neue Partnerschaften. Ob auf Seite der Kinder oder der Eltern – wer in die Familie „hineinheiratet“ oder Teil eines Patchwork wird, bringt eigene Werte, Bindungen und Vorstellungen mit.
Das allein ist nicht das Problem – das Problem ist, wenn es niemand ausspricht.
Viele Konflikte rund ums Erben und Schenken entstehen nicht durch Geld – sondern durch das Gefühl, nicht gesehen oder benachteiligt zu werden. Neue Dynamiken müssen nicht eskalieren – aber sie sollten frühzeitig erkannt und reflektiert werden.
Wenn Schwiegerkinder mitreden – Wer neu dazukommt, bringt neue Prioritäten mit
Partner und Schwiegerkinder sehen das Familienvermögen oft aus einem neuen Blickwinkel:
- Aus dem der eigenen kleinen Familie
- Aus dem Bedürfnis nach Absicherung
- Oder schlicht aus pragmatischer Sicht: „Was ist gerecht – für uns?“
Ein paar typische Denkweisen:
- „Warum bekommt deine Schwester mehr – nur weil sie näher dran war?“
- „Dein Bruder hat das Grundstück bekommen – und wir?“
- „Deine Eltern wollen uns doch bestimmt benachteiligen – die mögen mich nicht.“
Hier treffen unterschiedliche Loyalitäten aufeinander: die zur Herkunftsfamilie und die zur neuen Partnerschaft.
Und beide sind emotional legitim – aber in Kombination hoch explosiv, wenn es ums Vererben oder Verschenken geht.
Wenn die Eltern neu heiraten – oder einen Partner haben
Nicht nur die Kinder bringen Partner mit. Auch Eltern selbst finden nach einer Trennung oder nach dem Tod des Ehepartners wieder einen neuen Lebensmenschen.
Was für das Herz gut ist, kann für die Familie eine Herausforderung werden.
Drei typische Spannungsfelder:
- Neuer Partner wird als „fremd“ erlebt
– besonders, wenn der andere Elternteil noch sehr präsent ist oder „verklärt“ wird - Befürchtung, dass Vermögen zur neuen Familie wandert
– besonders bei testamentarischer Einsetzung des neuen Partners oder gemeinsamen Anschaffungen - Unklarheit über Loyalitäten des überlebenden Elternteils
– „Sind wir jetzt weniger wichtig?“
Gerade hier hilft: offene Kommunikation, Einbindung, gegebenenfalls klare Regelungen im Testament.
Wer nicht möchte, dass die neue Partnerschaft zum familiären Spaltpilz wird, sollte klare Zeichen der Abgrenzung und Zugehörigkeit setzen.
Was tun, um Konflikte zu vermeiden?
Reden hilft – ja, aber gezielt und reflektiert.
- Schenkende oder Erblasser können auch mit Schwiegerkindern sprechen.
Das heißt nicht, dass sie mitentscheiden dürfen – aber es zeigt Wertschätzung, wenn man fragt: „Habt ihr Erwartungen?“ - Es kann helfen, gemeinsam zu vereinbaren, dass Entscheidungen – etwa zur Aufteilung von Immobilien – unter den leiblichen Kindern abgestimmt werden. Das nimmt Druck aus der Konstellation.
- Verantwortung dort lassen, wo sie hingehört:
Entscheidungen trifft der, der schenkt oder vererbt – aber mit Blick auf das große Ganze. - Und alles Wichtige festhalten.
Denn was heute verstanden wird, kann morgen schon wieder anders erinnert werden. Dokumentation ist kein Misstrauen – sondern Fürsorge.
Fazit: Neue Beziehungen bringen neue Dynamiken – und brauchen Klarheit
Ob Schwiegerkinder, Patchwork oder neue Partner der Eltern: Wer einmal „neu“ in die Familie kommt, bringt auch neue Perspektiven mit. Das ist menschlich – und oft bereichernd. Doch wenn Vermögen im Spiel ist, treffen Gefühle auf Erwartungen – und Erwartungen auf alte Verletzungen.
Wer hier nicht rechtzeitig redet, läuft Gefahr, dass Loyalitäten sich verhärten und alte Familienbande reißen.
Die Lösung ist kein Misstrauen – sondern kluge Kommunikation.
Denn nichts schützt die Familie so sehr wie das offene Wort zur richtigen Zeit.
6. Dokumentieren – ist ein guter Anfang
Der erste Schritt zur Klarheit ist immer das Gespräch. Und wer weiter denkt, kann auch schriftlich festhalten, was gesagt wurde – als Erinnerung und Gesprächsgrundlage. Aber: Solche Notizen oder Briefe ersetzen niemals eine rechtlich fundierte Regelung.
Denn:
- Private Notizen schaffen keine rechtliche Verbindlichkeit
und können im schlimmsten Fall sogar als ungültige Teil-Testamente missverstanden werden. - Unklare Formulierungen öffnen die Tür für Streit und Interpretation
(„war das eine Vorauszahlung auf den Erbteil?“ – „war es gleichwertig?“ – „war es überhaupt rechtens?“) - Einzelvereinbarungen können komplexe Zusammenhänge übersehen
– etwa Pflichtteilsrechte, Schenkungsfolgen, steuerliche Aspekte oder das Bewertungsrecht bei Immobilien.
Was macht wirklich Sinn?
- Gespräche führen – offen, ehrlich, gemeinsam.
Diese schaffen Verständnis – auch, wenn man (noch) keine Regelung trifft. - Wünsche & Gedanken schriftlich festhalten – als Gesprächsprotokoll oder Gedankenpapier.
Nicht bindend, aber hilfreich für alle Beteiligten. - Rechtssicherheit durch Fachleute schaffen.
Wenn aus Gedanken ein Plan wird, sollte er auch juristisch korrekt umgesetzt werden – durch Notar oder Anwalt, nicht durch eigene Formulare.
Fazit: Dokumentation ersetzt keine Beratung – aber sie kann helfen, die richtigen Fragen zu stellen.
Wer mit der Familie redet und sich rechtlich absichert, sorgt für Klarheit – nicht für neue Fallstricke.
7. Verantwortung annehmen – wer gibt, sollte auch führen
Schenken oder vererben ist mehr als ein juristischer oder steuerlicher Akt.
Es ist eine Entscheidung, die tief in familiäre Strukturen eingreift – und langfristige Dynamiken prägt. Trotzdem drücken sich viele vor der Verantwortung: „Die Kinder werden das schon regeln“ oder „Es wird sich schon alles finden.“
Genau dieses Wegducken kann später zum Auslöser für Streit und Verletzungen werden.
Wer heute verteilt, sollte auch den Mut haben, zu führen. Und das beginnt nicht beim Notar – sondern im Kopf.
Verantwortung beginnt mit einer klaren Haltung
Es ist nicht Aufgabe der Kinder, über Gerechtigkeit zu entscheiden – sondern der Eltern, die geben.
Wer Schenkungen tätigt oder Verfügungen trifft, sollte sich bewusst machen: Jede Entscheidung – oder auch jede Unterlassung – sendet eine Botschaft.
Wer sich nicht festlegt, delegiert die Verantwortung an die Hinterbliebenen. Und das kann verheerende Folgen haben.
Ein klarer Standpunkt dagegen bedeutet:
- Ich habe nachgedacht.
- Ich habe Gründe für meine Entscheidungen.
- Und ich bin bereit, sie zu erklären.
Diese Haltung schafft Orientierung – und oft auch Respekt, selbst wenn Entscheidungen nicht jedem gefallen.
Wer entscheidet, muss auch mit der Reaktion leben
Keine Entscheidung bleibt ohne Reaktion – und manchmal auch nicht ohne Enttäuschung.
Aber es ist besser, wenn sich jemand über eine klar getroffene Entscheidung ärgert, als wenn Geschwister sich gegenseitig zerstreiten, weil keiner weiß, was „Mama gewollt hätte“.
Ein Beispiel:
Wird ein Haus an ein Kind überschrieben, aber ohne klare Aussage, ob und wie die anderen Kinder ausgeglichen werden, entsteht ein Vakuum – das oft durch Misstrauen gefüllt wird.
Wer sich seiner Verantwortung stellt, übernimmt auch die unangenehme Rolle – und schützt damit die, die zurückbleiben.
Nachvollziehbarkeit statt Harmonieversprechen
Nicht jede Regelung muss als “gerecht” empfunden werden – aber sie sollte nachvollziehbar sein.
Denn dann können selbst enttäuschte Familienmitglieder sagen:
„Ich hätte es mir anders gewünscht – aber ich verstehe, warum es so entschieden wurde.“
Was es dazu braucht:
- Transparente Gedanken zur Vermögensverteilung
- Erläuterungen, z. B. in Form eines Briefes oder Gesprächs
- Keine leeren Versprechen wie „wir gleichen das schon irgendwann aus“
Beispiel:
„Kind A erhält heute 50.000 Euro, weil es ein Haus baut. Kind B kann denselben Betrag als Unterstützung nach dem Studium abrufen“
Klar, ehrlich, nachvollziehbar. Und es zeigt: Es wurde nicht einfach nur „so gemacht“.
Fazit des Kapitels: Wer schenkt oder vererbt, trägt die Verantwortung – nicht die Erben
Die Verantwortung, dass es später nicht zum Streit kommt, liegt nicht bei den Kindern – sondern bei denen, die heute Entscheidungen treffen.
Das bedeutet auch: Manchmal braucht es Mut, in eine Rolle zu schlüpfen, die nicht bequem ist.
Aber wer klar kommuniziert und offen erklärt, der nimmt den Druck von den Schultern der Nachkommen.
Selbst wenn es später Unmut geben sollte – die Verantwortung bleibt dort, wo sie hingehört.
Und das ist oft der entscheidende Schritt in Richtung Frieden.
Entscheidungen, die verbinden – nicht spalten
Erbschaften und Schenkungen sind mehr als Zahlen in einem Notarvertrag oder Freibeträge in einer Steuererklärung. Sie erzählen Geschichten. Von Vertrauen, Verantwortung – und manchmal auch von Verletzungen.
Wo Vermögen weitergegeben wird, geht es selten nur um Geld. Es geht um Nähe. Um Familiengeschichte. Um das Gefühl, gesehen und gehört zu werden.
Deshalb ist es so wichtig, dass jene, die Vermögen übertragen wollen – sei es durch Testament oder Schenkung – auch die Zeit finden, sich selbst zu fragen:
- Was möchte ich hinterlassen?
- Und wie kann das, was ich gebe, verbinden – statt zu trennen?
Es braucht keine perfekten Lösungen. Aber es braucht Haltung. Und das ehrliche Bemühen, Entscheidungen nachvollziehbar und achtsam zu treffen.
Denn manchmal ist der größte Wert, den man vererben kann, nicht das Haus oder das Konto –
sondern der Frieden, der bleibt.